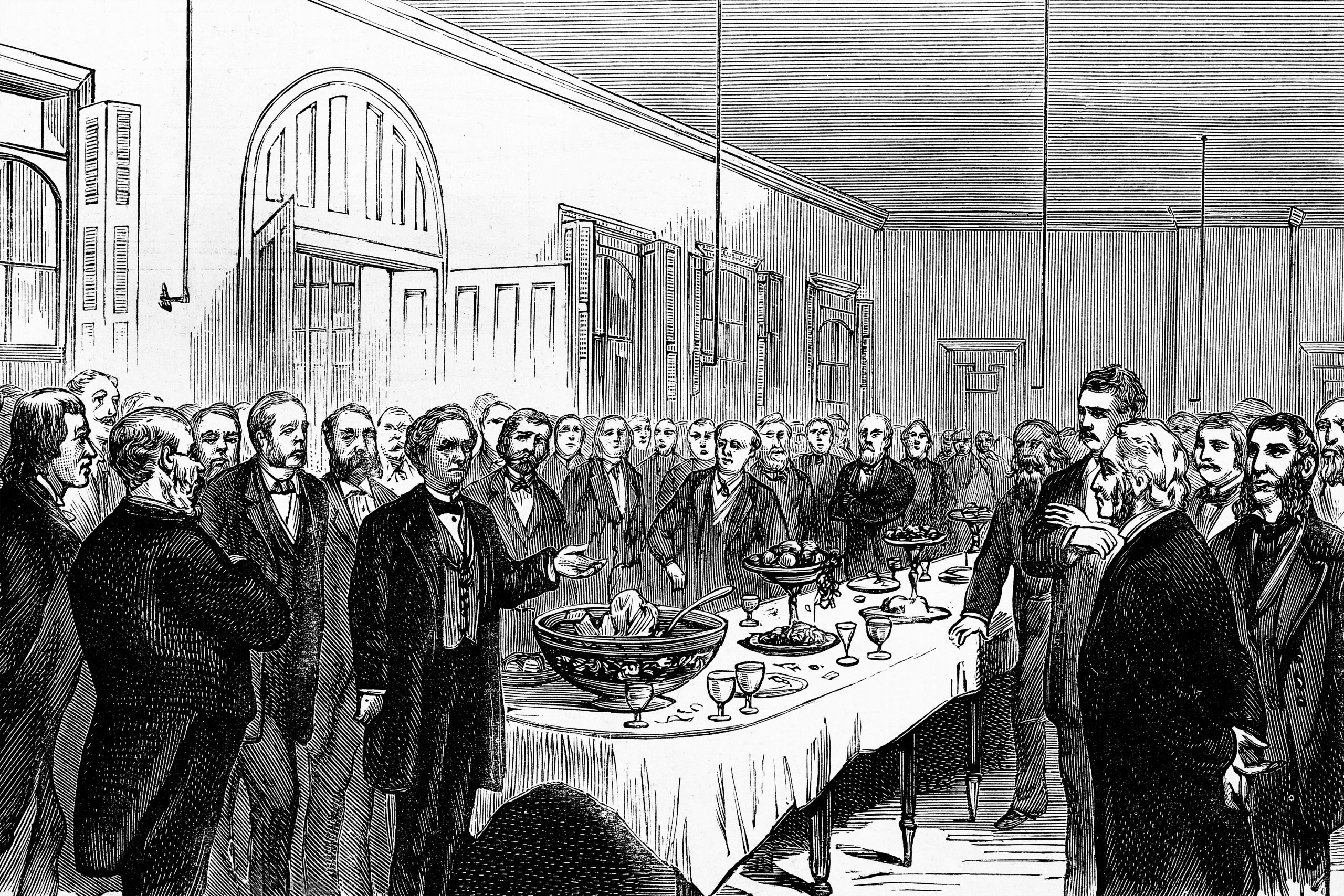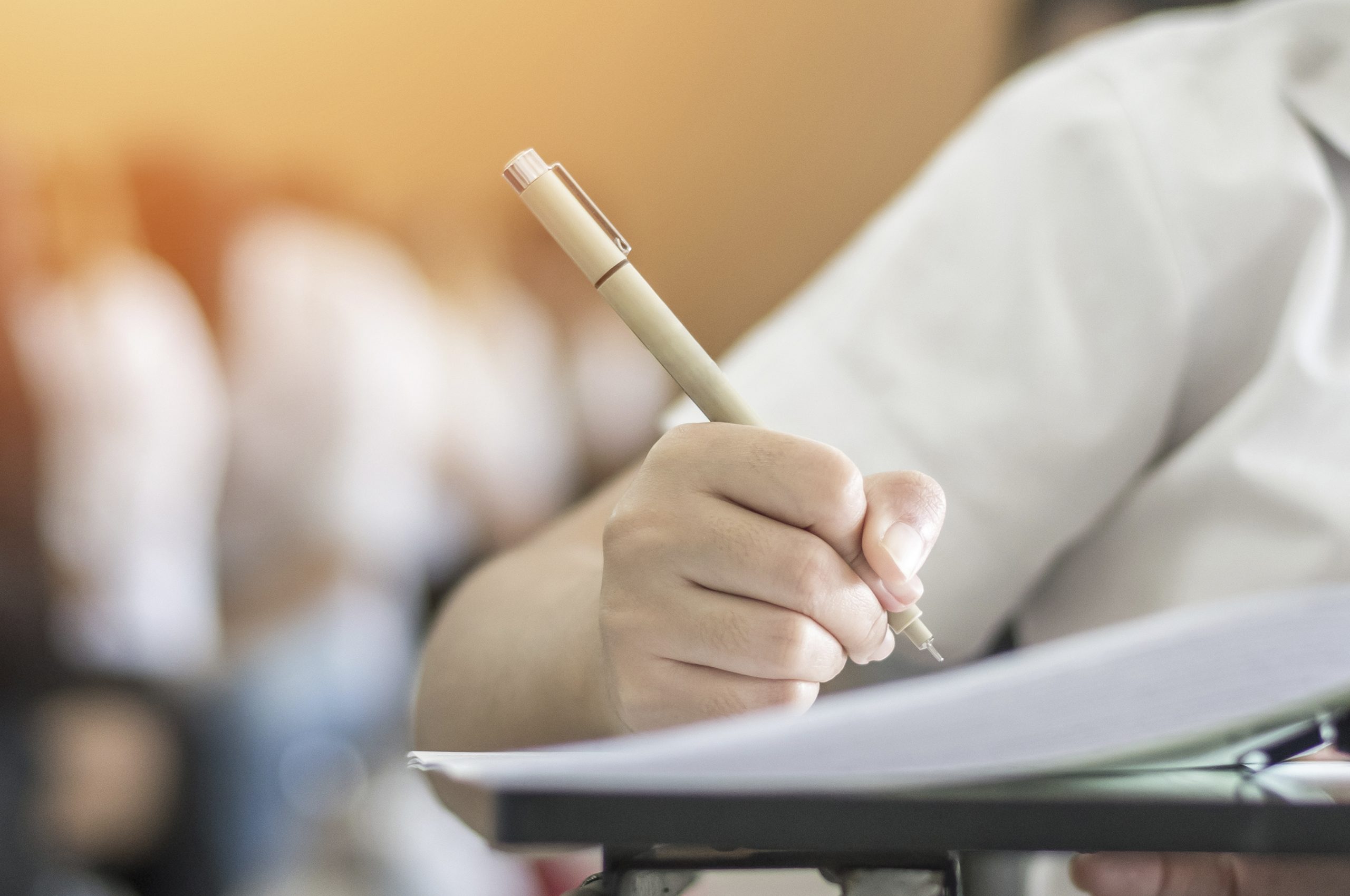NEUESTE BEITRÄGE
Mitmachen und die Homöopathie als Wahlleistung der Krankenkasse retten!
Der SPD-Gesundheitsminister Prof. Lauterbach will den Krankenkassen (GKV) nun per Gesetz verbieten, Homöopathie und Anthroposophische
Homöopathische Therapie des ADHS mittels Polaritätsanalyse
Rund 5% aller Kinder weltweit erhalten gemäß aktueller Erhebungen die Diagnose ADHS – somit
Aconitum napellus, der Sturmhut
Der Sturmhut ist auch als Blauer Eisenhut bekannt und eine häufig in den Alpen
NEUESTE BEITRÄGE
Mitmachen und die Homöopathie als Wahlleistung der Krankenkasse retten!
Der SPD-Gesundheitsminister Prof. Lauterbach will den Krankenkassen (GKV) nun per Gesetz verbieten, Homöopathie und Anthroposophische
Homöopathische Therapie des ADHS mittels Polaritätsanalyse
Rund 5% aller Kinder weltweit erhalten gemäß aktueller Erhebungen die Diagnose ADHS – somit
Aconitum napellus, der Sturmhut
Der Sturmhut ist auch als Blauer Eisenhut bekannt und eine häufig in den Alpen
VIDEOS ZUR HOMÖOPATHIE
Hier finden Sie demnächst informative Videos zur Homöopathie.
WICHTIGE THEMEN
VIDEOS ZUR HOMÖOPATHIE
Hier finden Sie demnächst informative Videos zur Homöopathie.